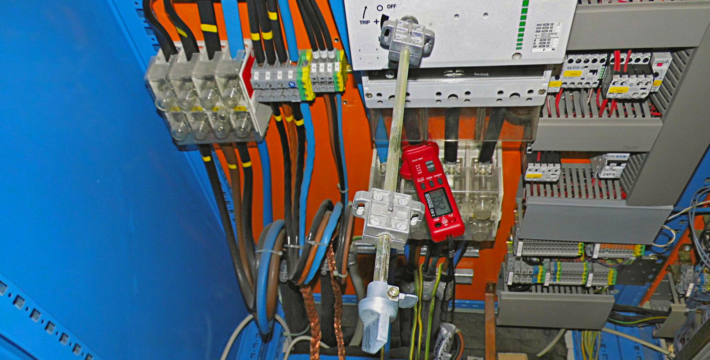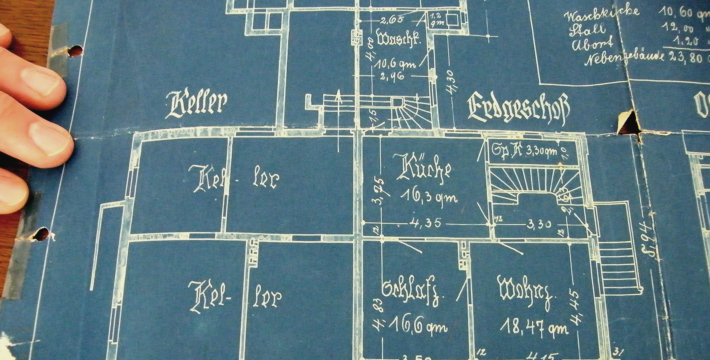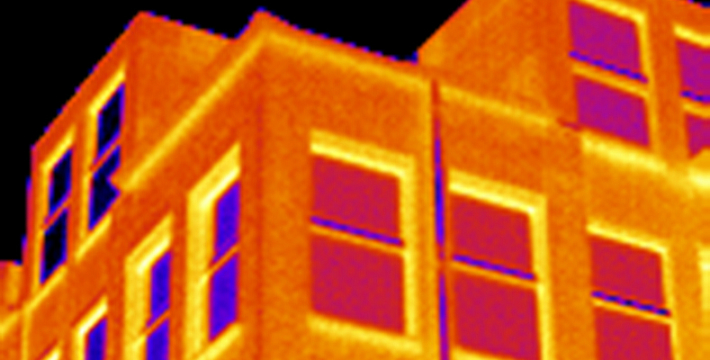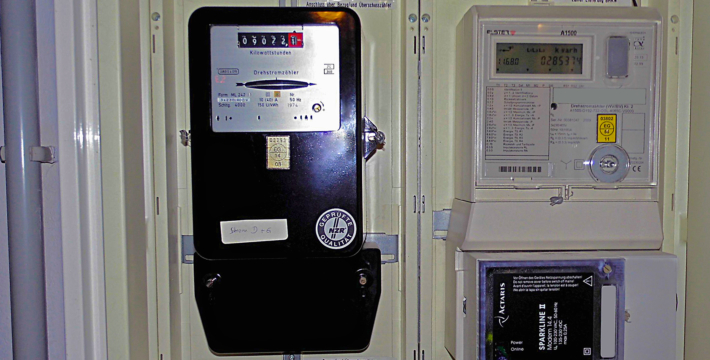Das Bundeswirtschaftsministerium verspricht, Fördermittel in der aktuellen Krise durch das Coronavirus nicht umzuschichten: »Die Haushaltsmittel für unsere bestehenden Förderprogramme im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien bleiben unverändert gesichert«, heißt es in einem Rundschreiben, »hierzu zählt insbesondere die Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft – Zuschuss, Kredit und Förderwettbewerb.« Das Ministerium kündigt außerdem an, die Pflicht für ein Energieaudit nach DIN EN 16247–1 in der nächsten Zeit nicht zu überprüfen: »Das BAFA wird daher Unternehmen, die ihr Energieaudit aufgrund der Corona-Pandemie nicht fristgerecht durchführen können, nicht sanktionieren.«
Nach wie vor gehört allerdings eine Vor-Ort-Begehung zu einem Energieaudit: »Somit ist das Energieaudit erst vollständig abgeschlossen, wenn auch die Vor-Ort-Begehung durchgeführt wurde«, informiert das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA auf seiner Website.
Wie zuvor ist es also möglich, Anträge für die Förderprogramme zur Energieeffizienz zu stellen. Die gesamten vorgesehenen Fördermittel sollen nicht in die Corona-Hilfspakete fließen: »Denn unsere investiven Förderprogramme leisten einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Konjunktur in Deutschland, der gerade vor dem Hintergrund der abträglichen wirtschaftlichen Wirkungen der Corona-Pandemie unverändert weiter aufrecht erhalten bleiben soll«, erklärt Abteilungsleiter Thorsten Herdan aus dem Ministerium.
Die derzeitigen Belastungen rechtfertigten Verspätungen bei anstehenden Energieaudits, ist im Rundschreiben zu lesen: »Im Rahmen seines Ermessensspielraums wird das BAFA vielmehr von einem unverschuldeten Fristversäumnis ausgehen.« Unternehmen sind nicht mal verpflichtet, die Verzögerung dem BAFA anzukündigen. Entgegen der bisherigen Praxis kontrolliert das BAFA nicht durch Stichproben, ob die betroffenen Nicht-KMU pünktlich ihr Energieaudit durchführen. Allerdings können sich diese Unternehmen nicht befreien lassen: Nach der Krise müssen sie das Audit oder Reaudit nachholen. Das BAFA wird rechtzeitig auf seiner Website »eine angemessene Frist« setzen und dann eine individuelle Begründung für eine Verzögerung verlangen – zum Beispiel »wegen Coronakrise kein Betretungsrecht durch Externe«, formuliert das BAFA auf seinen Internet-Seiten.
Etwas mehr Aufwand ist mit einem laufenden Energieaudit verbunden, falls betriebliche Einschränkungen durch das Coronavirus einstweilen die notwendige Vor-Ort-Begehung verhindern. Eine Dokumentation für den Aufschub könne erläutern, ob etwa »begründete Verdachtsfälle bestanden, der Betrieb komplett oder für Externe (Energieauditoren) geschlossen wurde oder es aus anderen Gründen nicht möglich war, dem Geschäftsbetrieb normal nachzugehen« – so das BAFA auf der Website: »Je ausführlicher die Dokumentation ist, desto hilfreicher ist es für die Beurteilung.« Wenn das Unternehmen »die Corona-bedingte Ausnahmesituation« überwunden hat, muss es die Vor-Ort-Begehung »unverzüglich« nachziehen.
Auch unter den ungewöhnlichen Umständen berät das Planungsbüro ENTECH zuverlässig über Fördermittel für energetische Maßnahmen – über die veränderten Abläufe informiert ein eigener Artikel. In diesem gesonderten Beitrag ist ebenso zu erfahren, wie die Energieberater Sie beim Energieaudit und bei der Vor-Ort-Begehung unterstützen.