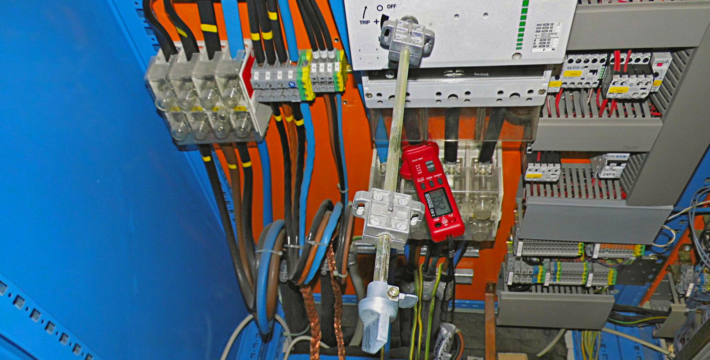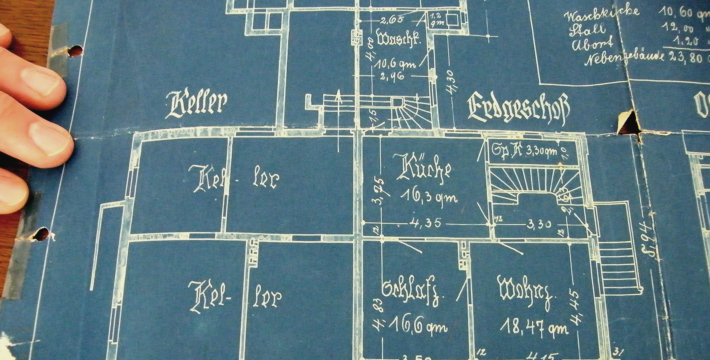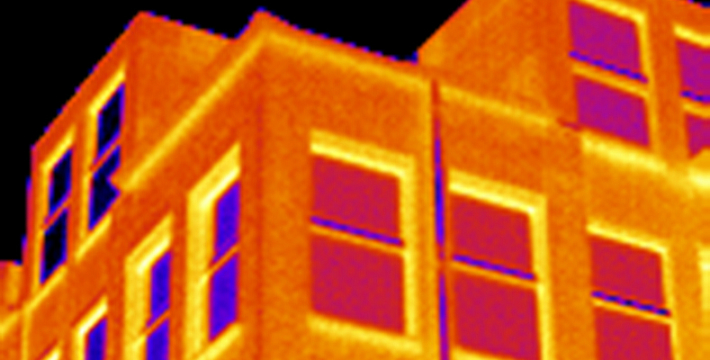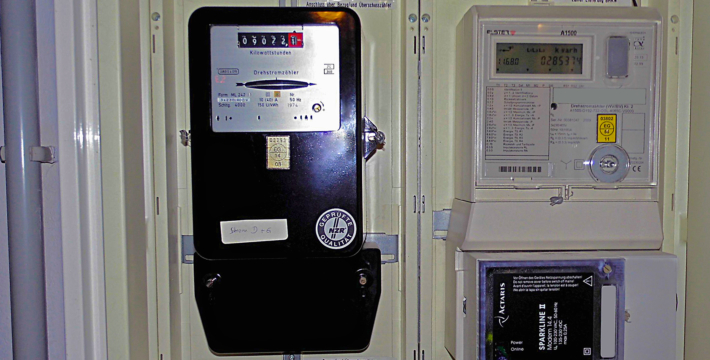(Pressemitteilung) […] Wer in Nordrhein-Westfalen auf eine klimafreundliche Wärmeversorgung umsteigt, erhält ab sofort deutlich mehr Unterstützung vom Land. Besonders profitieren Bürgerinnen und Bürger, die eine Wärmepumpe mit Erdwärme-Nutzung anschaffen. Für eine Erdwärmebohrung gibt es bei Neubauten statt 5 Euro zukünftig 35 Euro pro Bohrmeter. Bei Bestandsbauten steigt die Förderung von 10 Euro auf 50 Euro pro Bohrmeter. Auch die Installation von Erdwärme-Kollektoren wird stärker unterstützt. Dafür hat das Land sein Förderprogramm »progres.nrw – Klimaschutztechnik« überarbeitet. […] Continue reading
Tag Archives: Klimaschutz
Förderprogramm »progres.nrw – Klimaschutztechnik« kehrt zurück
(Pressemitteilung) NRW unterstützt Umstieg auf erneuerbare Wärmequellen – mit einem starken Fokus auf klimaschonende Wärmequellen wie Erdwärme, Abwasserwärme und Sonnenenergie setzt das Land sein Förderprogramm »progres.nrw – Klimaschutztechnik« fort. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Kommunen wieder Anträge für Fördermittel stellen. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt insgesamt mehr als 11,5 Millionen Euro zur Verfügung, um die Wärmewende zu beschleunigen.
Continue readingNeubau Effizienzhaus 55 ab Februar 2022 ohne BEG Förderung
Für den Neubau von einem
- Effizienzhaus 55 (Wohngebäude)
- oder Effizienzgebäude 55 (Nichtwohngebäude)
fließt laut KfW Bankengruppe ab 1. Februar 2022 keine Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG: An diesem Stichtag soll diese Förderstufe abgeschafft werden. Die Förderungen für Effizienzhaus 40 und Effizienzhaus 40 Plus sowie für Effizienzgebäude 40 sollen hingegen erhalten bleiben.
KfW nennt BEG Konditionen für Neubauten
KfW-Infos für Wohngebäude (Stand November 2021)


KfW-Infos für Nichtwohngebäude (Stand November 2021)
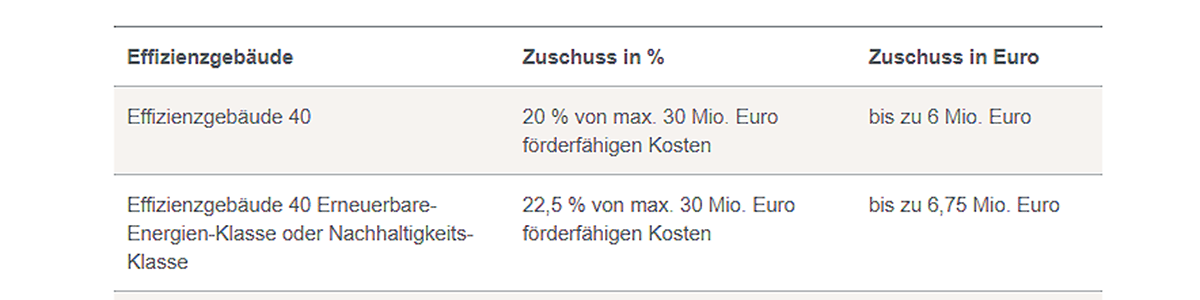

Empfehlungen zur Reform vom Februar 2022
Bitte halten Sie bei der BEG die Frist bis 31. Januar 2022 ein, wenn Sie noch Fördergelder für einen Neubau von einem Effizienzhaus 55 oder Effizienzgebäude 55 erhalten wollen. Oder wir beraten Sie über die Chance, dass die KfW mehr Geld zahlt – sofern Sie strengere Ansprüche zum Energieeinsatz erfüllen. Das Bundeswirtschaftsministerium empfiehlt in den FAQ seiner Aktion »Deutschland macht’s effizient«: »Die Planungen werden vor Antragstellung auf ein höheres Effizienzhaus-/Effizienzgebäudeniveau (EH bzw. EG 40) umgeplant. Bei einem ambitionierteren Effizienzhaus-/Effizienzgebäude-Niveau ist derzeit eine um mindestens 5 Prozentpunkte höhere Förderung möglich«.